REMID
Religionswissenschaftlicher Medien- und Informationsdienst e. V.
Prof. Sebastian Murken war 1989 eines von sieben Gründungsmitgliedern des Religionswissenschaftlichen Medien- und Informationsdienstes REMID e.V. 1997 wurde er als Gutachter für die Enquete-Kommission “Sogenannte Sekten und Psychogruppen” des Deutschen Bundestages berufen (siehe Endbericht, 1998). REMID interviewte ihn zu diesem Anlass über neue religiöse Bewegungen, den Sektenbegriff und psychotherapeutische Praxis für sogenannte “Aussteiger”.

REMID arbeitet nicht mit dem Sektenbegriff. Trotzdem erhalten wir weiterhin insbesondere von Medien viele Anfragen, die von “Sekten” handeln. Nocheinmal kurz für unsere neueren Leser*innen: Was ist am Sektenbegriff problematisch?
Der Sektenbegriff ist ein stigmatisierender und ausgrenzender Begriff. Sicherlich gibt es auch problematische Gruppen, allerdings gilt es dann, genau hinzuschauen. In problematischen Fällen dann von “Sekten” zu sprechen, ist nicht hilfreich oder differenzierend.
Wir bei REMID erhalten nur relativ wenige Anfragen, welche Hilfe wegen einer problematisierten Mitgliedschaft suchen. Allerdings wenn handelt es sich häufig um Angehörige, Eltern oder Freunde der Person, die sich in eine neureligiöse Gruppe begeben hat. Wie sind Ihre Erfahrungen?
Ich kenne beides. Oft sind es erst Angehörige oder Freunde, die sich melden. Manchmal aber auch direkt Betroffene. Allerdings hängt das dann auch mit dem Profil der Gruppierungen zusammen. Oft sind es nicht so sehr die Glaubensinhalte, die problematisch sind, sondern die Gruppendynamik der Gemeinschaft, die als belastend erlebt werden kann.
Was ist damit konkret gemeint?
Wenn die Heilserwartung einer Gruppe und ihrer Lehre an hohe Erwartungen an die Gläubigen geknüpft ist, die sie einhalten müssen, um „gerettet“ zu werden, können starke Konflikte und Schuldgefühle entstehen.
Wie ist das eigentlich: Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wenn jemand aus einem neureligiösen Hintergrund psychische Hilfe sucht, dann gibt es einerseits Beratungsangebote, Psychotherapeut*innen oder Einrichtungen, welche – sagen wir – nicht unbedingt sensibel sind für das Thema, andererseits gibt es Angebote, welche eher dazu tendieren, zu einem gemäßigten christlichen Selbstverständnis zurückzuführen, also eine Rekonversion des potenziellen “Sektenaussteigers” zu begünstigen?
Da haben Sie recht. Nehmen wir zum Beispiel einen Zeugen Jehovas, der psychotherapeutische Hilfe sucht. Die ZJ als Gemeinschaft sind dafür durchaus offen und wissen selbst, dass unter ihren Gläubigen der Anteil derer mit psychischer Labilität nicht ungleich demjenigen der Gesamtbevölkerung ist. Nun gibt es in der psychotherapeutischen Praxis ein Dilemma: herkömmliche Therapeut*innen gehen oft zu schnell davon aus, dass die psychische Störungsresultat der Mitgliedschaft bei den Zeugen Jehovas sei. Aussteigerinitiativen oder kirchlich orientierte Therapeuten ermuntern schnell dazu, die Gemeinschaft zu verlassen. Es finden sich nicht viele Angebote, die die psychische Störung behandeln und ernst nehmen, ohne die Mitgliedschaft in einer spezifischen Gemeinschaft sofort als Teil des Problems zu sehen. Bei Patienten die der evangelischen oder katholischen Kirche angehören, wird dies strukturell erst einmal ganz anders angegangen.
Sie arbeiten ja aktiv gegen dieses Dilemma…
Ja, ich arbeite als Therapeut und Dozent in verschiedenen Ausbildungsgängen für werdende Psychologische Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen (sebastian-murken.de) wichtig ist mir, nicht von vorneherein zwischen guter und schlechter Religiosität zu unterscheiden, sondern im Einzelfall zu untersuchen, wer in welcher Gemeinschaft auf welche Weise profitiert oder durch spezifische Elemente belastet wird. Dies bedeutet, die Opferperspektive, die lange vor herrschte (böse Sekten schnappen gute Menschen), durch eine differenzierte Perspektive der Wechselwirkung zwischen Angebot von Religiosität und Spiritualität auf der einen Seite und Bedürfnislage der Individuen auf der anderen Seite zu ersetzen.
Also wenn ich an Menschen denke, welche z.B. aus den genannten Zeugen Jehovas “ausstiegen”, wird diese “Sektenzeit” in der Tat häufig wie ein Trauma behandelt…
Hier müssen wir unterscheiden. Es ist ein grundsätzlicher Unterschied, ob jemand in eine Gruppierung hineingeboren wurde, und sich somit nicht für eine Mitgliedschaft entschieden hat. Hier ist die Lehre und Erfahrung der Gruppe, das einzige interne Referenzsystem, was, beim Ausstieg, zu extremen Schwierigkeiten führen kann. Davon unterscheiden müssen wir die selbst gewählte Mitgliedschaft in einer Gruppe, die oft auf der Basis einer Sozialisation geschieht, die unabhängig von der Lehre der Gruppe war. Hier ist es oft so, dass die Gruppe zu einer spezifischen Zeit und Lebensphase bestimmte Bedürfnisse erfüllt hat, während zu einem späteren Zeitpunkt eher die Kosten der Mitgliedschaft in den Vordergrund rücken, was dann zu einem Ausstieg führen kann. Diese jeweilige Dynamik zu verstehen ist ein spannender Prozess, sowohl für den Betroffenen, als auch für mich als Begleiter.
Was möchten Sie schließlich unseren Leser*innen auf den Weg mitgeben?
Wichtig ist, dass das Thema entpathologisiert wird. Auch neureligiöse Experimente und spirituelle Sinnsuche gehören zum ganz normalen Leben. Und nicht jeder braucht Hilfe, der eine neue religiöse Bewegung verlassen möchte. Es ist falsch, in diesem Bereich von einem besonderen Bedarf auszugehen. Die meisten Anfragen zu dem Thema erhalte ich von Medien, nicht von Betroffenen. Häufiger ist der Anteil derer, welche als Klienten esoterische Konzepte in ihre Therapie mitbringen. Und auch da ist es entscheidend, wie der Therapeut damit umgeht. Aber grundsätzlich gilt für alle diese Bereiche – eben auch den religiösen, genauso wie für die Liebe oder den Beruf: Das Leben hat seinen Gewinn und seinen Preis.
Danke für das Interview.
Das Interview führte Kris Wagenseil im Dezember 2015.
Inhaltliche Kürzungen von Mona Stumpe (2023)
Informationen zu Prof. Sebastian Murkens Arbeit gibt es unter religionspsychologie.de.
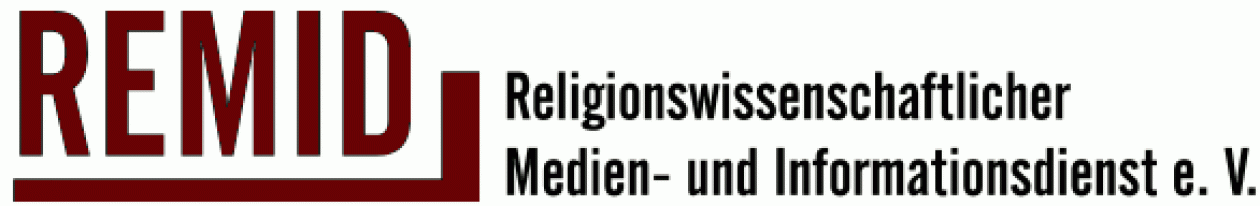

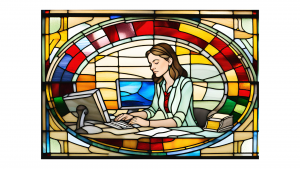


[…] Unterschied religiös – spirituell oder religiös – esoterisch oder religiös – sektenartig aufgemacht (oder religiös – Humbug). Sicherlich wurde moniert, dass die Sätze des […]
[…] etwa Dr. Michael Blume mit den Evolutionary Religious Studies und Prof. Sebastian Murken mit seinen religionspsychologischen Arbeiten. Schließlich können lose Interviews ergänzt werden wie das von Ihnen gefundene zur […]