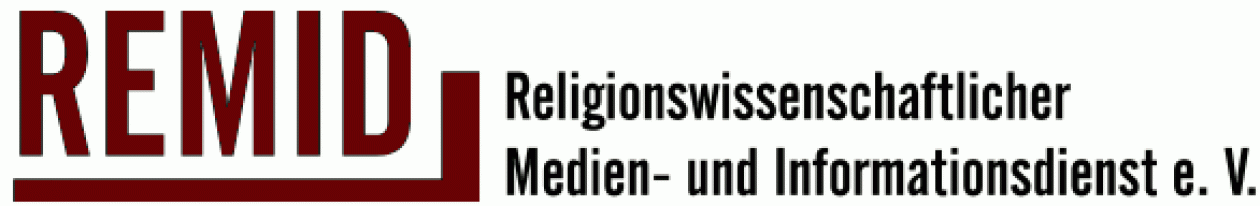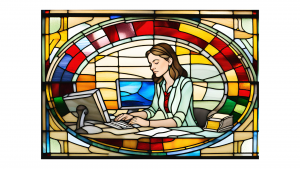REMID
Religionswissenschaftlicher Medien- und Informationsdienst e. V.
Christoph Peter Baumann, ehemaliger Leiter von Inforel in Basel, hat ein Buch zur “Sikh-Religion in der Schweiz” vorgelegt. Die Sikh-Religion ist eine der zahlenbezogen kleineren Weltreligionen mit rund 27 Millionen Mitgliedern und zählt in der Schweiz zu den kleinsten Religionsgemeinschaften. Zum Buch führte REMID ein Interview mit dem Autoren.

Du beginnst mit einer persönlichen Beziehung zur Sikh-Religion. Du botest in deinem Haus Platz für einen Gurdwara. So nennen Sikhs ihre Gebets- und Schulstätte. Und wie sollten sich die Leser*innen das vorstellen, ein Religionswissenschaftler bietet einer Religionsgemeinschaft einen Raum an, ohne zu konvertieren?
Zu dieser Zeit bot unsere Familie mehreren Religionsgemeinschaften Gastrecht: Tamilische Hindu, eine Sri-Chinmoy-Gruppe, eine Meditationsgruppe, eine buddhistische Gruppe und diverse Gruppen für einzelne Anlässe und Treffen. So war die Sikh-Gruppe eine unter mehreren Religionsgemeinschaften.
In der Nacherzählung der Geschichte der zehn Gurus taucht bei Nummer 9 der Begriff “Religionsfreiheit” auf und bei Nummer 10 der wiederholte Hinweis, dass der neben dem ab sofort (um 1700) für alle männlichen Sikhs geltenden Zunamen Singh, “Löwe”, für alle Frauen gewählte Zuname Kaur ist, “Prinzessin” — aber: “grammatikalisch richtig Prinz”. Die sozialen Unterschiede, welche mit dem Familiennamen verbunden waren, sollten getilgt werden. Das klingt alles sehr modern? Wie ähnlich oder eben verschieden sind diese modern erscheinenden Reformen mit solchen in Europa um diese Zeit? Schließlich vom heutigen Standpunkt aus gefragt, ist es ja sehr interessant, dass hier die weibliche grammatische Form getilgt wird. Hat das Gründe? Was steckt hinter diesem mythischen Bild von Löwen und Prinzen?
«Die sozialen Unterschiede, welche mit dem Familiennamen verbunden waren, sollten getilgt werden.»: Dies ist auch im heutigen Indien aktuell, weil jeder Name Rückschlüsse auf die Religion und bei Hindus auf die Kaste zulässt. Auch ich als Schweizer kann bei vielen Hindunamen auf die Kaste schließen. So gehört zum Beispiel ein «Sharma» zur Brahmanenkaste.
Dass ich nicht einfach die Übersetzung von Kaur als “Prinzessin” übernehme, liegt daran, dass ich nach über 20 Jahren Sprachstudien (unter anderem Sanskrit) gelernt habe, genau hinzuschauen. Warum aber Kaur gewählt worden ist und nicht eines der möglichen anderen Wörter für Prinz, entzieht sich meiner Kenntnis.

Im Blog gab es mal einen Gastbeitrag “Vom Ursprung des Sikhismus bis zum Traum von Khalistan” von Sabine Liesche (2017), welcher ein wenig tensions with believers (Michael Pye) provozierte. Mehrere Stellungnahmen des Deutschen Informationszentrum für Sikh Religion, Sikh Geschichte, Kultur & Wissenschaft wurden schließlich durch eine längere Replik der Gastautorin mit bibliographischen Nachweisen beantwortet. Es ging um den zweiten Teil ihres Artikels zum “Traum von Khalistan” und insbesondere um “Gewalttaten gegenüber Hindus” im historischen “Sikh-Konflikt” (sie bezieht sich u.a. auf eine Forschungsarbeit von Marla Stukenberg mit diesem Titel, die ich auch bei dir im Buch wiedergefunden habe). Wie gehst du mit dem Thema um?
Da ich kein Historiker bin, nehme ich diese Untersuchungen zur Kenntnis. Meine Einschätzungen habe ich vor allem auf den Seiten 21–25 beschrieben.
“Die Sikh-Religion vertritt einen bildlosen Monotheismus wie der Islam, glaubt wie der Hinduismus an Wiedergeburt, ist aber trotzdem kein Synkretismus dieser beiden Religionen. Es ist eine eigenständige Religion” (S. 14). Ähnlich hast du das ja auch oben gesagt. [Vielleicht]. Nun ist die Angabe von Elementen, also es gibt im Christentum jüdische Elemente, solche aus den Mithras-Mysterien, aus der Theurgia eines Apollonius von Tyana usw. eigentlich historisch banal. Ich brauche dafür auch nicht wirklich die zusätzliche Bezeichnung “Synkretismus”. Vielmehr ist es doch sein Gegenteil, was sozusagen eine emisch-religiöse Fiktion begrifflich kreiiert, die Offenbarung des Christentums als einzigartige und überhaupt einzige Gestalt eines Nicht-Synkretistischen. Und der Begriff “Weltreligionen” ist dann so eine Art Kompromiss, wenigen anderen diese nicht-synkretistische Einzigartigkeit zuzugestehen. Wie viel hat so etwas auch immer mit Identitätspolitik zu tun?
Die Grenzen waren fließend. Die klare Abgrenzung kam erst später, als Hindus die Sikhs zu vereinnahmen versuchten.
Deine Beschreibung “Weltreligionen” als “so eine Art Kompromiss, wenigen anderen diese nicht-synkretistische Einzigartigkeit zuzugestehen” lehne ich ab.
Ich verwende den Begriff “Weltreligionen” selbst nicht. Mir ging es darum, dass “Synkretismus” und “Weltreligionen” als Begriffe auf eine gemeinsame wertende Betrachtung der Religionen der Welt zurückgreifen. Kommen wir zu etwas Anderem: In der Geschichte der Sikh-Religion in der Schweiz geht es zunächst um “richtige” und “provisorische” Gurdwaras. Was macht für dich den Unterschied?
Ein «richtiger» Gurdwara ist ein Gebäude, das für diesen Zweck gebaut wurde, ein provisorischer ist entweder ein Raum in einem bestehenden Haus (zum Beispiel der erste «Gurdwara» in unserem Haus und diejenigen in Genf und Bassersdorf).
Auf S. 39 erwähnst du Verzeichnisse zum Auffinden bestimmter Inhalte heiliger Schriften — und das wäre ohne schwierig. Warum? Wie wird da mit Texten gearbeitet?
Die Arbeit mit Texten habe ich auf den Seiten 41–47 beschrieben. Im Gegensatz zur Bibel gibt es keine vergleichbare Einteilung nach Kapiteln, so ist es ohne diese Verzeichnisse fast unmöglich, eine bestimmte Textstelle zu finden.
Eine Sikh-Frau soll sogar keinen Schleier tragen oder ihr Gesicht anderweitig verborgen halten (S. 54), aber wie ist das mit den 5 K und gibt es da vergleichbare gesellschaftliche Debatten wie beim muslimischen Kopftuch in der Schweiz? Auf S. 101 finde ich dazu, dass seit 1996 der Turban eines von drei Themen sei, weswegen über Sikhs in den Medien berichtet werde.
Debatten wie beim muslimischen Kopftuch konnte ich nie feststellen. Wenn darüber berichtet wird, geht es zum Beispiel um die Helmpflicht auf einem Motorrad, so wie in Deutschland zur Zeit über das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig berichtet wird. Sikhs haben immer wieder Schwierigkeiten, weil sie oft mit Muslimen verwechselt werden.
Den Schluss Deines Buches bildet eine klassische Lokale Religionsforschung, welche alle Schweizer Einrichtungen vorstellt, mit Fotos, Geschichte, Einordnung und Kalender regelmäßiger Veranstaltungen. Nun ist diese Art lokaler Religionsforschung die Goldgrube schlechthin gewesen, für eine dem Paradigma religiöser Vielfalt verpflichtete Religionsstatistik wie die unsere von REMID. Allerdings scheint — nachdem solche Forschungen eine Periode lang gefördert worden waren — dieser Fördertrend vorbei zu sein. REMID ist für eine Aktualisierung gerade nicht-christlicher Neuer Religiöser Bewegungen jetzt vermehrt auf Monographien wie Doktorarbeiten etc. angewiesen. Wie veränderlich erscheint dir dagegen das religiöse Feld? Sollten solche lokalen Religionsforschungen wieder neu aufgelegt werden?
Solche lokalen Religionsforschungen sollten unbedingt wieder neu aufgelegt werden!

In den Niederlanden, schreibst du auf S. 12, ist Healthy, Happy, Holy Organization (3HO) “als westlicher Zweig der Sikh-Religion zuzuordnen”, in der Schweiz sei der Verband 3ho Shweiz Kundalini Yoga “politisch und konfessionell neutral”. Deswegen fehlt sie, was ich bedauerlich finde, auch in der Lokalen Religionsforschung ab S. 121. Dabei ordnen sich beide genannten nationalen Organisationen der 3ho Foundation International zu. Wie ist denn überhaupt 3HO in all das Bisherige einzuordnen?
Früher, das heißt, in den 1990er Jahren, war 3HO auch in der Schweiz der westliche Zweig der Sikh-Religion. In unserem Buch «Religionen in Basel-Stadt und Basel-Landschaft» (Basel 2000) führten wir sie im Kapitel «Erloschene oder in Basel nicht mehr vorhandene Religionsgemeinschaften» auf. Die vormalige Leiterin der Gruppe in Basel verstand sich als Sikh und nahm auch einen Sikh-Namen an.
Der aktuelle Verein «3ho Schweiz Kundalini Yoga» wurde 2002 gegründet. 2008 erhielt ich von der Verantwortlichen dieses Vereins bei der Frage nach dem Verhältnis zur Sikh-Religion die Antwort «3HO ist offen gegenüber allen Religionen.» So heißt es auch in den Statuten: 2009 im Artikel 2.3: «3HO Kundalini Yoga Schweiz ist politisch und konfessionell neutral.» 2017 im Artikel 1: «Er ist politisch und konfessionell neutral.» So war es für mich klar, dass 3HO nicht in das Buch «Sikh-Religion in der Schweiz» gehört.
Danke für das Interview.
Das Interview führte Kris Wagenseil.