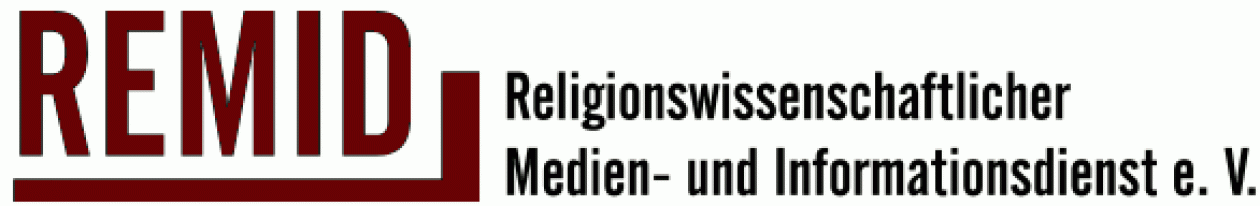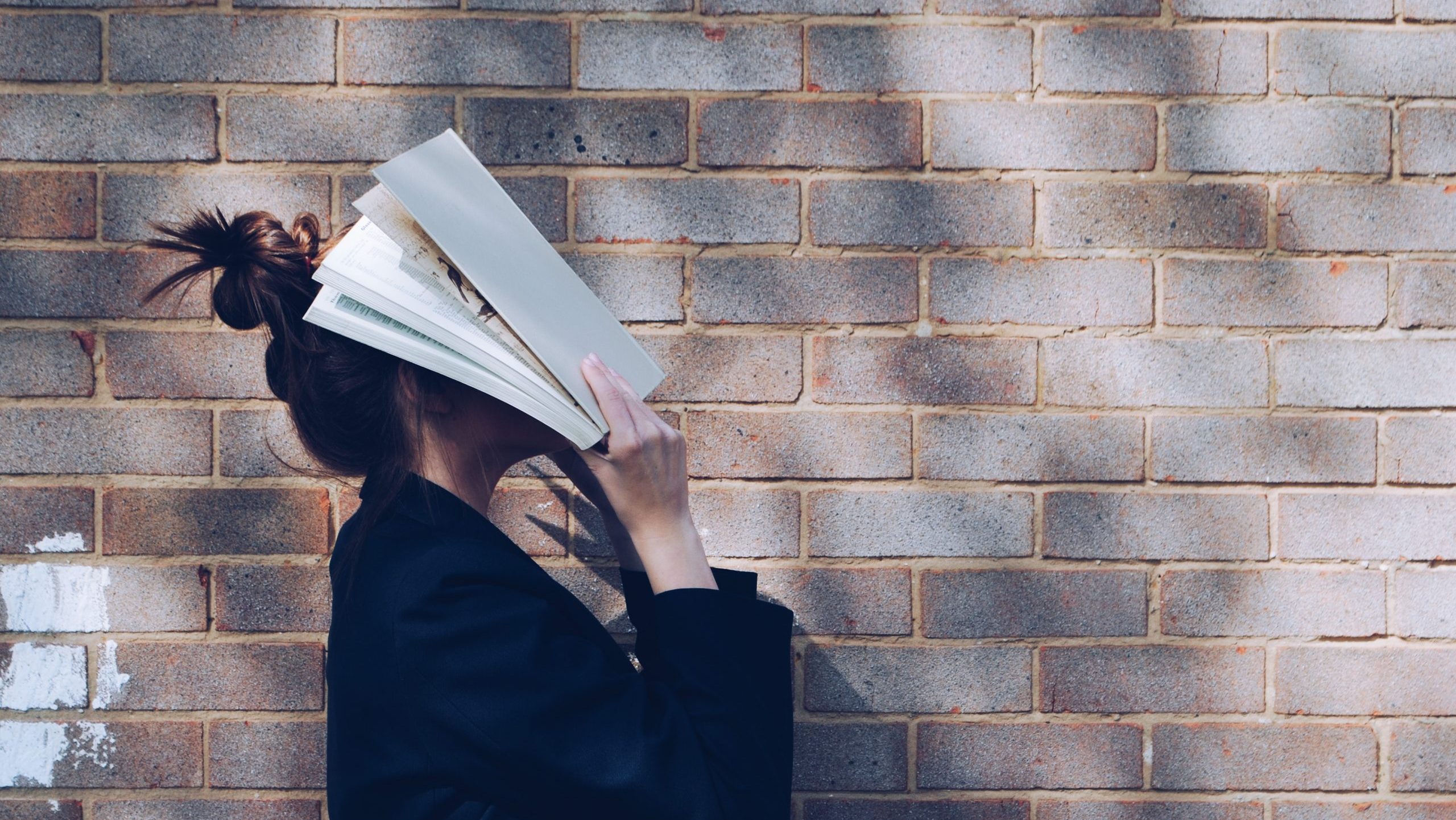REMID
Religionswissenschaftlicher Medien- und Informationsdienst e. V.
Mitgliederzahlen: Protestantismus

Sie finden unsere Statistiken hilfreich? Um diese weiterhin kostenfrei und für alle zugängig anbieten zu können, sind wir für jede noch so kleine Spende dankbar. Jeder Euro zählt für uns! Ihre Unterstützung ermöglicht es uns, unser Angebot aufrechtzuerhalten und auszubauen.
Die aktuelle Unterteilung des Christentums
Die aktuelle Unterteilung des Christentums in drei Kategorien innerhalb der REMID-Religionsstatistik Deutschlands stammt ursprünglich aus der Gewohnheit, zwischen Protestantismus, Katholizismus und Orthodoxie zu unterscheiden. Diese Einteilung bietet jedoch auch die Möglichkeit, die vielfältigen Gemeinschaften systematisch zu erfassen. Insbesondere wird die Kategorie “Freikirchen und Sondergemeinschaften” durch Bezugnahme auf protestantische oder reformatorische Stiftungsakte definiert und erweitert. Dadurch können auch nicht-trinitarische (und damit nicht-nizänische) Gruppen wie die Zeugen Jehovas Teil dieser Kategorie sein, da sie die Dreieinigkeitslehre ablehnen. Gemeinsam ist diesen Kirchen, Gemeinschaften und Bewegungen gerade die Ablehnung traditioneller Dogmen.
Historische Öffnung durch den “radikalen” Pietismus
Bereits im sogenannten “radikalen” (separatistischen) Pietismus der Frühen Neuzeit konnte dies eine Öffnung für die Übernahme von Elementen aus anderen Traditionen, zum Beispiel der Weisheitslehre oder “Mystik” der jüdischen Kabbalah, bedeuten. Ähnliche Tendenzen lassen sich heute im charismatischen und pfingstlerischen Christentum beobachten, wenn es um die Integration lokaler Traditionen aus Afrika, Asien oder Amerika geht.
Der weite Begriff des Protestantismus bis heute
Der Protestantismusbegriff blieb “bis in die unmittelbare Gegenwart offen für all die neuen christlichen Gruppierungen, Erweckungsbewegungen, Denominationen und Kirchenbildungen, die neben der römisch-katholischen ‘Weltkirche’ und der östlichen, orthodoxen Kirchen ein religiös, theologisch und ethisch eigenständiges Christentum repräsentieren” (Graf, Der Protestantismus, München 2006, S. 18). In diesem Sinne verwendet REMID an dieser Stelle einen weiten Protestantismusbegriff (insgesamt: 1,8 Mio. Angehörige von Freikirchen / Sondergemeinschaften neben den Evangelischen Landeskirchen, vor 2013 waren es 1,5 Mio.).
Eine Ausnahme bilden von Rom unabhängige katholische Kirchen (s. Katholizismus), in einigen Fällen Neuoffenbarungen oder starke Kombination mit z.B. hermetischen, gnostischen oder östlichen Lehren (s. Sonstige).
Mitgliedschaften in Vereinigungen und Arbeitsgemeinschaften
Die Mitglieder der Vereinigung Evangelischer Freikirchen (VEF) zählen demgegenüber lediglich 297.000 (Stand 2020, mit Gastmitgliedern; 2016: 225.700 ohne und 266.216 mit Gastmitgliedern; 2013: 259.550; 2007: 237.100; Zahl tw. ohne Angehörige), daneben die übrigen in der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen (ACK) vertretenen Freikirchen 392.000 (Stand 2020; 2012: 332.914; 2010: 330.274, Angaben nach EKD). Mitgliedschaften werden im Folgenden verzeichnet.
Mitgliederzahlen: Evangelische Landeskirchen (EKD)
20.236.000
2020 / Kirchliche Statistik zum 31.12.2020. Mitglied ACK. Einige Landeskirchen sind Mitglied im Lutherischen Weltbund bzw. im Reformierten Weltbund (seit 2010 Weltgemeinschaft Reformierter Kirchen). Schlüssel als KdÖR (altkorporiert): ev, eu oder lt (Gliedkirche Evangelisch-reformierte Kirche: rf).
Rückgang 2020 ggb. 2017: ‑1.299.858; 2017 ggb. 2016: ‑386.329; 2016 ggb. 2015: ‑350.740; 2015 ggb. 2014: ‑356.359; 2014 ggb. 2013: ‑411.106; 2013 ggb. 2012: ‑315.704; 2012 ggb. 2011: ‑263.552; 2011 ggb. 2010: ‑276.441; 2010 ggb. 2009: ‑298.897; 2009 gegenüber 2008: ‑319.943
Laut Zensus 2011 gibt es 24.328.100 Angehörige der evangelischen Kirche (öffentlich-rechtlich), davon 24.094.090 mit und 234.000 ohne deutsche Staatsbürgerschaft.
Im Evangelischen Gnadauer Gemeinschaftsverband e. V. mit ca. 300.000 Mitgliedern sind innerhalb der EKD organisiert: 38 regionale Gemeinschaftsverbände (zwei davon in Österreich, einer in den Niederlanden), 6 Jugendverbände, 11 seminaristisch-theologische Ausbildungsstätten, 7 Missionsgesellschaften, 16 Diakonissen-Mutterhäuser und 10 Werke mit besonderer Aufgabenstellung (2012 / Eigenangabe).
Der Lutherische Weltbund zählt für Deutschland 10.814.631 Lutheraner (2019; 2011: 12.551.580; ohne unierte u. reformierte Gliedkirchen; neben Mitgliedskirchen mit SELK u. ELFK).
Mitgliederzahlen: Freikirchen & Sondergemeinschaften in Deutschland
Neuapostolische Kirche
311.124
2022 / NAK. Schlüssel als KdÖR: na (Anerkennung: Nordrhein-Westfalen 1951, Bremen 1952).
Stichtag: 1. Januar 2022. Vorige Angaben: 315794 (2021; ‑4.670), 338.161 (2016; ‑22.367), 342.202 (2015; ‑4041), 345.871 (2014; ‑3.669). Rückggängig 2014 ggb. 2013: — 1.883; 2013 ggb. 2012: ‑2.620; 2012 ggb. 2011: ‑3.191; 2011 ggb. 2010: ‑3.402; 2010 ggb. 2009: ‑2.866. Stand: 01.01.2017. 1.744 (2015: 1.870) Gemeinden.
Historische Angaben (Dt. Reich/Weimarer Republik): 1890: 21.000, 1910: 76.000, 1925: 140.000 (Hölscher, Geschichte der protestantischen Frömmigkeit in Deutschland, 2005, S. 354). “In (West- und Ost-) Deutschland stiegen sie zwischen 1955 und 1975 zwar noch von 369 000 auf 410 000, gingen jedoch bis 1995 auf 399 000 zurück” (Henkel, Atlas, 2001, S. 215).
Freie Baptisten- und Mennonitengemeinden
ca. 290.000
2007 / Klassen: Russlanddeutsche Freikirchen, S. 368. “Freikirchliche Angehörige, Eingew.” (mit Nachwuchs: ca. 436.000; 80.000 Gemeinde-Mitgl.). Löwen (Russlanddeutsche Christen, S. 18) geht für 2010 von ca. 500.000 Baptisten/Mennoniten und ihren Angehörigen sowie von 100.000 getauften Mitgliedern darunter aus.
550 freie Gemeinden, v.a. Aussiedler der Nachfolgestaaten der Sowjetunion (GUS).
Zeugen Jehovas
170.491
2022 / JZ. Stand: Mai 2022. Schlüssel als KdÖR: jz (seit 2005).
Vorige Angaben: 169.272 (2021; +1.219 JZ. Stand: Aug. 2021), 168.763 (Nov. 2016; +509). Veränderung 2016 gegenüber 2014: + 2.045; 2014 ggb. 2012: ‑221; 2012 ggb. 2011: + 1.720; 2011 ggb. 2007: + 39; zuvor Veränderung gegenüber 2006: + 755. TeilnehmerInnen am jährlichen Gedächtnismahl: ca. 275.000 (Umfeld 100.000).
Historische Angaben: “Während die Literatur in Anschluss an Kater von 4.000 bis 5.000 Getöteten […] ausgeht, bedeutet die im Geschichtsbericht der Wachturm-Gesellschaft genannte Zahl von 838 registrierten Getöteten auf 25.000 Zeugen Jehovas im Deutschen Reich des Jahres 1933 bezogen einen Prozentsatz von 3,35%” (Garbe: Zwischen Widerstand und Martyrium. Die Zeugen Jehovas im “Dritten Reich”, 1999, S. 498).
Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden
(Baptisten und Brüdergemeinden, Baptistische Kirche im Baptistischen Weltbund BWA)
73.878
2022 / BEFG (Stichtag 28.05). Davon 8.756 (2020) in Brüdergemeinden (2017: 9.219; 2016: 9.229; 2014: 9.170; 2013: 9.157; 2012: 9.003). Mitglied VEF, ACK. Schlüssel als KdÖR: ba oder ef (1951 bestätigt zuerst Hessen die 1930 von Preußen verliehenen Körperschaftsrechte; Löser 2008, S. 7).
Vorige Angaben: 77.685 (2020 BEFG Stichtag 31.12); — 4.672; 82.357 (2017; ‑4.672). Veränderung 2017 gegenüber 2016: +357; 2016 ggb. 2015: +70; 2015 ggb. 2014: +460; 2014 ggb. 2013: ‑299; 2013 ggb. 2012: ‑405; 2012 ggb. 2011: +74; 2011 ggb. 2010: ‑564; 2010 ggb. 2007: ‑1.432; 2007 ggb. 2006: — 933. Zusätzlich 30.000 betreute Kinder und Jugendliche. Ältere Angaben: 87.349 (1997). Laut Volkszählung 1925 im damaligen D. 70.000 Baptisten (Garbe, Zwischen Widerstand und Martyrium, S. 10, Anm. 6).
Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden
64.800
2022 / BFP. Mitglied VEF, Gastmitglied ACK. Schlüssel als KdÖR: pf (bewilligt zuerst in Hessen 1974). Ca. 830 (2018: 829; 2011: 757) Gemeinden. Angaben zum 01.01.2019: Insgesamt rund 181.255 (2013: 146.000, 2011: 138.000) Zugehörige, das sind getaufte Mitglieder plus nichtgetaufte Familienangehörige sowie 95.477 regelmäßige Besucher der Veranstaltungen, darunter etwa 22.906 (2015: 24.000; 2013: 23.000; 2011: 20.000; 2009: 16.000) Kinder und Jugendliche.
Vorige Angaben: 62.872 (2019; +1.928) 56.275 (2018; +6.597). Veränderung 2018 ggb. 2015: +4.379; 2015 ggb. 2013: + 2.908; 2013 ggb. 2011: +2.762; 2011 ggb. 2009: +2.124 (bei 729 Gemeinden). Seit 1988 ist die Volksmission entschiedener Christen e.V. und seit 2000 bzw. 2008 die Ecclesia-Gemeinde der Christen e.V. (ECC) aufgenommen (s.d.).
Historische Angaben: “Die zweitstärkste Pfingstbewegung [neben dem Gemeinschaftsverband Mülheim-Ruhr], die Elim-Bewegung, hatte bis zu ihrem Verbot und ihrer Aufnahme in den Bund evangelischer Freikirchen 1938 etwa 5.000 Mitglieder” (Sommer in Heinz: Freikirchen und Juden im “Dritten Reich”, 2011, S. 130). Nach BFP-Erhebung 1996: 28.000; 1998: 29.500; 2000: 34.500; 2002: 37.000; 2004: 39.500; 2006: 39.000; 2009: 44.102; 2011: 46.228.
Mennonitenkirchen
(in der Mennonitischen Weltkonferenz)
51.771
2022 / Mennonitische Weltkonferenz (getaufte Mitglieder). Tw. Überschneidungen mit Aussiedlergemeinden, siehe dort. Schlüssel als KdÖR: mt. Vorige Angaben: 44.714
(MWK 2017); 40.675 (MWK 2015); 47.202 (MWK 2013); 40.000 — 50.000 (REMID 2005).
Vorige Angaben: 47.492 (2018; +4.279)
Bund Taufgesinnter Gemeinden 7.000 (2013; 2005: 6.100 — 1989: 2.500; 1997: 5.000; vgl. Löwen: Russlanddeutsche Christen, 2014, S. 28), Arbeitsgemeinschaft zur geistlichen Unterstützung in Mennonitengemeinden (AGUM) 5.984 (2005: 5.600), Arbeitsgemeinschaft mennonitischer Gemeinden/AMG (2013: 5.100, 2010: 5.350; 2005: 5.800; Mitglied VEF, ACK), Arbeitsgemeinschaft der Mennonitischen Brüdergemeinden in Deutschland (AMBD) 1.600 (2009; 2005: 1.900), Verband Mennonitischer Brüdergemeinden in Bayern 137 (2005: 300), Arbeitsgemeinschaft der vier WEBB-Gemeinden (Wolfsburg, Espelkamp, Bechterdissen und Bielefeld) 1.600, Mennonitischen Heimatmission (AGAPE Gemeindewerk) 128 (2005: 200), Bruderschaft der Christengemeinde in Deutschland (Aussiedler; 20.000 in 66 Gemeinden, 2015); unabh. Kirchgemeinden 445, unabh. Brüdergemeinden 5.000 (2013).
Historische Angaben: Laut Volkszählung 1925 im damaligen D. 13.000 Mennoniten (Garbe, Zwischen Widerstand und Martyrium, S. 10, Anm. 6).
Evangelisch-Methodistische Kirche (EMK)
45.989
2022 / EMK. Mitglied VEF, ACK. Schlüssel als KdÖR: em (IEVR: “hervorgegangen aus dem Zusammenschluss der ‘Evangelischen Gemeinschaft’ und der ‘Bischöflichen Methodisten Kirche’, die beide den Körperschaftsstatus zwischen 1925 und 1936 erhalten hatten”). 432 Gemeinden (Stand 2007: ca. 57.000 in 526 Gemeinden; 2010: 55.065; 2017: 50.137 in 454 Gemeinden). Zahl enthält Angehörige und Kinder.
Vorige Angaben: 46.292 (2020; ‑303), 50.137 (2017; ‑3.845 im Vergleich zu 2020). Veränderung 2017 ggb. 2016: ‑1.894; 2016 ggb. 2015 ‑402; 2015 ggb. 2014: ‑806; 2014 ggb. 2013: ‑472. Ausschließlich formale Kirchenmitglieder 2013: 31.800 (2008: 33.364).
Historische Angaben (Bischöfliche Methodistenkirche): 1919: 22.000, 1932: 34.000 (Stemmler, Frühjahrstagung des Vereins für Freikirchenforschung, 2011). Evangelische Gemeinschaft: 1924: 24.000, 1952: 26.000 (Handbuch der deutschen evangelischen Kirchen, 1918 bis 1949, Bd. 1, 2010, S. 307). Laut Volkszählung 1925 im damaligen D. 49.000 Methodisten (Garbe, Zwischen Widerstand und Martyrium, S. 10, Anm. 6).
Bund Freier evangelischer Gemeinden
42.350
2022 / FEG (12.12.). Mitglied VEF, Vollmitglied ACK (bis 2021 Gastmitglied). Schlüssel als KdÖR: feg. Ca. 500 (2017: 479; 2013: 450) Gemeinden. Angaben ohne Kinder. Hinzu kommen fast 10.000 Kinder und etwa 15.000 Freunde.
Vorige Angaben: 43.149 (2019; ‑799), 41.203 (2017; +1.946). Veränderung 2017 ggb. 2013: + 830; 2013 ggb. 2011: + 873; 2011 ggb. 2010: + 1.000; 2010 ggb. 2007: + 2.500; 2007 ggb. 2005: + 3.000.
Historische Angaben: 1874: 1.275, 1900: 3.687, 1920: 8.200, 1930: 12.088, 1940: 18.041, [W‑Deutschl.:] 1950: 20.224, 1960: 21.492, 1970: 21.032, 1980: 22.948, 1989: 26.644, 1999: 32.070, 2005: 36.109 (Weyel: Geschichte des Bundes, 2013, S. 345ff.).
Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage (Mormonen)
38.739
2022 / REMID. KdÖR in Hessen (1953), Berlin (1954), Rheinland-Pfalz (2013), Sachsen (2014), Nordrhein-Westfalen (2015), Hamburg (2016), Bremen (2017). Vorige Angaben: 40.037 (2017; ‑313).
Vorherige Angaben: 39.724 (2021; ‑985), Veränderung 2017 ggb. 2015: +311; 2015 ggb. 2014: + 325; 2014 ggb. 2013: + 662; 2013 ggb. 2011: + 482; 2011 ggb. 2007: + 42; 2007 ggb. 2005: + 2.768.
Historische Angaben der Mitgliederverwaltung: Es handelt sich jeweils um die Gesamtmitgliederzahl in Deutschland; 1930: 11.828, 1940: 13.481, 1950: 15.350, 1960: 16.656, 1970: 22.247, 1980: 32.063, 1990: 38.515, [Inventur der Mitgliederdaten] 2000: 36.359.
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten (STA)
34.000
2022 / APD. Gastmitglied VEF, ACK. Schlüssel als KdÖR: av (erste Anerkennung: Hamburg 1952, Nordrhein-Westfalen 1957).
Getaufte Mitglieder zum 31.12. In 548 (2010: 570; 2017: 559) örtlichen Gemeinden. Zusätzlich ca. 2.000 (2014; 2005: 5.000) nicht getaufte Kinder und Jugendliche.
Vorige Angaben: 34.415 (2020; ‑415), 34.948 (2017; ‑533), 35.195 (2010). Veränderung 2017 gegenüber 2014: +137; 2014 ggb. 2013: ‑90; 2013 ggb. 2012: ‑81; 2012 ggb. 2011: ‑117; 2011 ggb. 2010: ‑96; 2010 ggb. 2009: ‑191; 2009 ggb. 2008: ‑265; 2008 ggb. 2007: — 274
Historische Angaben: 1895 soll es in D. 700, 1911: 10.134 und 1914 ca. 15.000 Mitglieder gegeben haben (Faltin: Heil und Heilung. Geschichte der Laienheilkundigen, 2000, S. 94). Laut Volkszählung 1925 im damaligen D. 30.000 Adventisten (Garbe, Zwischen Widerstand und Martyrium, S. 10, Anm. 6).
Selbstständige Evangelisch-Lutherische Kirche (SELK)
32.411
2022 / Mitglied ACK, Internationaler Lutherischer Rat. Schlüssel als KdÖR: sel. Vorige Angaben: 33.474 (2016; ‑125).
Vorige Angaben: 33.349 (2018; ‑938), Veränderung 2016 gegenüber 2014: ‑299; 2014 ggb. 2013: ‑288; 2013 ggb. 2010: ‑1.079; 2010 ggb. 2007: ‑1.097; 2007 ggb. 2005: — 971
Historische Angaben: 37.000 (1987).
Unabhängige Afrikanische Kirchen
Unabhängige Afrikanische Gemeinden insgesamt: 30.000
2005 / REMID.
Deeper Christian Life Ministry / Deeper Life Bible Church (William Folorunso Kumuyi): ca. 1.500 — 2.000 in 17 Gemeinden
2018 / REMID.
Lighthouse Chapel Germany: ca. 1.000 in 11 Gemeinden
2018 / REMID. Pfingstlerisches Selbstverständnis, Mitglied in Pentecostal World Fellowship.
Bethel Prayer Ministry International: ca. 700 in 7 Gemeinden
2018 / REMID. Pfingstlerisches Selbstverständnis.
Combat Spirituel / Fondation Olangi-Wosho: ca. 500 in 3 Gemeinden
2010 / REMID.
Christ-For-All Evangelistic Ministries: 400 in 4 Gemeinden
2018 / REMID.
Église de Jesus Christ sur Terre par le Prophète Simon Kimbangu (Kimbanguisten): 180
2003 / REMID.
All Christian Believers Fellowship (ACBF): 120
2001 / REMID. Seit 2005 Mitglied im BFP.
Action Chapel International (Nicholas Duncan-Williams): ca. 100
2018 / REMID. Charismatisch. 2 Gemeinden.
Église du Christianisme Céleste / Himmlische Kirche Christi: 100
2010 / REMID.
Church of the Lord (Aladura): 50
2003 / REMID.
Brüderbewegung nach J. N. Darby (außerhalb BEFG)
27.000
2017 / REMID.“Insgesamt gibt es in Deutschland 535 Brüdergemeinden mit etwa 36.000 Mitgliedern, die in drei Gruppierungen aufgeteilt sind: die Gemeinden der AGB [Mitglied BEFG und damit Mitglied VEF; AGB mit ca. 9.000 Mitgliedern], die ‘Freien Brüder’ und die ‘Exklusiven’ ”. Vorige Angabe: 45.000 (Ruttmann 2005).
Lettische Evangelisch-Lutherische Kirche im Ausland
26.420
2013 / LWI. Stand: Feb. 2014. Mitglied Lutherischer Weltbund. Veränderung ggb. 2011: + 570. Internationale Mitgliederzahl, Sitz in Deutschland, genauer Anteil an Mitgliedern in D. unklar (geht nicht in Zählung ein).
Bruderschaft der Freien Evangeliums Christen Gemeinden
18.500
2019 / REMID. 118 Gemeinden (2011: 15.500 in 116), vorwiegend Russlanddeutsche.
Apostelamt Jesu Christi
8.700
2015 / EZW. Gastmitglied ACK. Schlüssel als KdÖR: ap. Vorige Angabe: 18.000 (Ruttmann 2005), 11.500 (REMID 2014). 1902 Abspaltung von der Neuapostolischen Kirche (NAK). Im Juli 2017 haben sich im Umfeld der 54. Apostelversammlung des AJC mehrere Gemeinden v. a. im Raum Berlin abgespalten und die „Freien Apostolischen Gemeinden e. V.“ (FAG) gegründet (EZW Materialdienst 5/2018).
Suomalainen kirkollinen työ Saksassa / Finnische kirchliche Arbeit in Deutschland
7.919
2015 / Eigenangabe. Stand: 31.12.2015. 18 Gemeinden. Vorige Angaben: 8.250 (Eigenangabe 2013), 10.000 (REMID 2011).
Bund evangelischer Gemeinschaften
7.385
2008 / REMID
Zusammenschluss von Gemeinschafts-Verbänden und Einrichtungen innerhalb des Deutschen Gemeinschafts-Diakonie-Verbands (DGD); Teil der evangelischen Landeskirchen.
Evangelisch-altreformierte Kirche in Niedersachsen
6.497
2020 / Grenzbote (01/21), Stichtag: 1.1. Mitglied ACK. Schlüssel als KdÖR: ea (Niederländisch-Reformierte Gemeinde zu Wuppertal: nlr). Seit 2013 Mitglied in Weltgemeinschaft reformierter Kirchen.
12 (2017: 14) Gemeinden im westlichen Niedersachsen und Wuppertal. Letzte Angaben: 6.542 (2017), 6.597 (2016), 6.794 (2013), 6.849 (2012), 6.977 (2007), 7.045 (2004).
Dänische Kirche in Südschleswig / Dansk Kirke i Sydslesvig
6.300
2012 / REMID. Stand: 1.1.2012. Vorige Angabe: 6.500 (2007). Teil der Dänischen Kirche im Ausland (entsprechend: Dänische Seemannskirche in Hamburg als KdÖR; 1.700 Dänen sind 2007 in der Hansestadt gemeldet).
Volksmission entschiedener Christen e.V.
6.000
2021 / “Besucher und Mitglieder”, volksmission.de. 53 (2012: 60) Gemeinden. Seit 1988 Mitglied im Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden (BFP, siehe dort). Vorige Angabe: 6.000 (2005), 4.300 (REMID 2012).
Vineyard D‑A-CH (Vineyard-Bewegung)
6.000 — 8.000
2012 / Eigenangabe. Zahl für Deutschland, Österreich, Schweiz und “Freunde”. 40 tw. unabhängige Gemeinden. Daneben innerkirchliche Gemeinden in der EKD oder kath. Kirche (Laienbewegung).
Siehe auch Kurzinformation Religion: Vineyard
Unity School of Christianity / Unity Church (New Thought)
5.000 — 6.000
2003 / REMID.
Evangelische Brüder-Unität (Herrnhuter Brüdergemeine)
4.990
2021 / EBU. Mitglied ACK, Gastmitglied VEF. Schlüssel als KdÖR: hb. Vorige Angaben: 5.290 (2018), 5.750 (2014), 5.800 (2013), 6.200 (2005). In der Volkszählung 1925 waren 6.450 Herrenhuter und Mitglieder “ihr nahestehender Religionsgesellschaften” aufgeführt (Stat. JB 1928, S. 9).
Mülheimer Verband Freikirchlich-Evangelischer Gemeinden
4.662
2019 / muelheimer-verband.de. Stand: 31.12.2018. Mitglied VEF, ACK. 44 (2016: 43) Gemeinden. Vorige Angaben: 4.509 (2016; +153). Zuwachs 2016 ggb. 2015: +22; 2015 ggb. 2014: + 49; 2014 ggb. 2013: + 238; 2013 ggb. 2011: + 160; 2011 ggb. 2005: ca. + 1000.
100 Jahre nach der Berliner Erklärung (2009) erschien eine gemeinsame Erklärung des Gnadauer Gemeinschaftsverbandes und des Mülheimer Verbandes: Die Berliner Erklärung und die Mülheimer Erwiderung “haben (…) für das gegenwärtige Miteinander von Gnadauer und Mülheimer Verband keine Bedeutung”.
Biblische Glaubens-Gemeinde (BGG International Stuttgart / Gospel Forum)
4.500
2013 / REMID. Darunter 1.500 Kinder und Jugendliche. Vorige Angabe: 2.800 (2006). 2019 spricht das Gospel Forum von 220.000 Besuchern im Jahr.
Gemeinde Gottes (Church of God, Cleveland) — Evangelische Freikirche
4.350
2021 / gemeindegottes.de. Seit 2004 Gemeinde Gottes in Deutschland KdöR. Mitglied VEF, Forum Freikirchlicher Pfingstgemeinden (FFP), Pentecostal European Fellowship (PEF), World Pentecostal Fellowship (WPF). Insgesamt 10.000 Zugehörige in 72 (2012: 70) Gemeinden in Deutschland. Vorige Angaben: 3.300 (REMID 2012). Veränderung Mitglieder 2012 ggb. 2010: +300, 2010 ggb. 2005: ‑500.
Ecclesia-Kirchen (vor 2021: Ecclesia-Gemeinde der Christen e.V.)
4.000
2005 / REMID. 75 Gemeinden. Seit spätestens 2008 Mitglied im Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden (BFP).
Evangelische Waldenserkirche (Deutsche Waldenserkirche / Freundeskreis der Waldenser)
3.500
2005 / REMID. Mitglieder zumeist aus ev. Landeskirchen, tw. aber auch aus ital. Waldensergemeinden (ca. 100). Die Evangelische Waldenser-Kirchengemeinde hat 2015 etwa 1.600 Gemeindeglieder (Bad Homburg v.d. Höhe), daneben gibt es seit 2009 die Deutsche Waldenser-Vereinigung e.V. mit 2017 ca. 900 Mitgliedern.
Jesus Freaks (Jesus Freaks International e. V.)
3.200
2015 / Teilnehmerangabe Freakstock, jesusfreaks.de. Mehr als 100 Regionalgruppen. 2013 auf Webseite vernetzte 1.750 Benutzer (ca. 2.000 Facebook-Fans), Auflage “Kranker Bote” 400 Druckexemplare plus 400 Downloads. Vorige Angaben: 2.000 (REMID, Schätzung der Zahl in D. 2007), 5.000 (EZW 2009, vermutlich mit Umfeld).
Reformiert-Apostolischer Gemeindebund / Apostolische Gemeinschaft
3.000 in 43 Gemeinden
2021 / apostolisch.de. 1994 Auflösung des RAG und den Beitritt seiner Mitglieder zur Düsseldorfer „Apostolischen Gemeinschaft e.V.“.
Letzte Angaben: 4.300 (2018 bei 50 Gemeinden); 5.559 (2011; bei 75 Gemeinden); 7.000 (2005); 12.000 (1999). Historische Angaben: 6.000 (1921); ca. 10.000 (1955).
Katholisch-Apostolische Gemeinde nach Edward Irving
3.000
2010 / EZW. Vorige Angabe: 8.000 (REMID 2005). Historische Angabe: Um 1900 etwa 70.000 (Obst: Apostel und Propheten der Neuzeit, 2000).
Freie Volksmission Krefeld e.V. (Branham-Bewegung)
3.000
2003 / REMID.
Johannische Kirche
3.000
2011 / REMID. Ca. 30 Gemeinden. Schlüssel als KdÖR: jk (Anerkennung 1990: Berlin, 1996: Brandenburg). Historische Angaben: 1934 soll es ca. 100.000 Mitglieder gegeben haben (Hutten: Seher, S. 695).
Churches of Christ / Gemeinden Christi (Restoration Movement)
2.800
2005 / REMID. 34 Gemeinden
Die Christliche Gemeinde e.V. DCG (Norwegische Brüder, Smiths Freunde, Brunstad Christian Church)
2.650
2020 / dcg-deutschland.de, Jahresbericht (1.800 erwachsene Vollmitglieder und 850 Minderjährige). 2021 zehn Gemeinden. Vorige Angabe: 2.500 (REMID 2012).
Nederlandse Kerk in Duitsland / Niederländische Kirche in Deutschland
2.500
2019 / REMID. 13 Gemeinden. Vorige Angabe: 8.000 (2011).
Freikirchlicher Bund der Gemeinde Gottes (Church of God, Anderson)
2.300
2021 / vef.de = Zahl Gottesdienstbesucher, es werden keine formellen Mitgliedslisten geführt. Mitglied VEF. KdÖR in Baden-Württemberg. 35 Gemeinden. Vorige Angabe: 2.200 (REMID 2017). Veränderung 2017 ggb. 2010: ‑300; 2010 ggb. 2005: ‑1000.
Universelles Leben
2.000 — 5.000
2005 / REMID. Urchristliches Selbstverständnis. 2018: Eigenangabe von 450 Vereinsmitgliedern “Das Universelle Leben Aller Kulturen weltweit e.V.”.
Freie Apostelgemeinden (z.B. Gemeinschaft des göttlichen Sozialismus — Apostelamt Juda)
2.000
2005 / REMID.
Christliche Gemeinschaft Hirt und Herde
2.000
2005 / REMID. Historische Zahlen: 7.000 (Wiss. Ath. 1984).
Hillsong Church
2.000
2014 / REMID. 2017: Vier Standorte.
Christadelphians
ca. 1.500
2018 / REMID. 14 Standorte in D. Antitrinitarisch.
Bund evangelisch-reformierter Kirchen Deutschlands
1.500
2012 / Eigenangabe. Schlüssel als KdÖR: rf. 3 Gemeinden (2005: 6). Vorige Angabe: 13.000 (2005). 2012 traten 3 Gemeinden der Evangelisch-reformierten Kirche bei.
Evangelisch-Lutherische Freikirche (ELFK)
1.246
2014 / elfk.de Gemeindebriefe 3/15. 16 Gemeinden vor allem in Sachsen. Mitglied in Konfessioneller Evangelischer Lutherischer Konferenz (KELK). Vorige Angabe: 1.317 (2010 / Gemeindebriefe 3/11).
Historische Angaben: 2.800 (1987).
Kirche des Nazareners
1.100
2018 / REMID. Mitglied VEF. 20 Gemeinden. Vorige Angabe: 1.300 (2010).
Heilsarmee
1.224
2020 / “Mitglieder”, heilsarmee.de, Jahresbericht. Mitglied VEF, ACK. Schlüssel als KdÖR: ha. 44 Gemeinden (2014: 47; 2010: 45). Mitgliederzahl 2014 (REMID): 3.000 umfasste 1.300 Heilssoldaten (2010: 1.063, 154 Offiziere, 421 Angehörige und 2.054 Gemeindezugehörige). Daneben oft Angabe von ca. 6.000 Freunden.
International Christian Fellowship
1.200
2013 / REMID. Neo-charismatisch. Ausrichtung an Willow Creek. 2021: 28 Gemeinden.
Christian Science / Christliche Wissenschaft
1.200
2010 / REMID. 98 Vereinigungen (2005 bei damals geschätzt 2.000 “Wissenschaftlern” in D.). Schlüssel als KdÖR: cw (Anerkennung: 1949 Bayern, 1950 Niedersachsen, 1952 Hamburg).
Siehe auch Kurzinformation Religion: Christan Science
Wallonisch-Niederländische Gemeinde, Hanau (Selbstständige ev.-reformierte Kirche)
1.129
2014 / REMID. KdÖR in Hessen. Vorige Angaben: 2010: 1.133; 2011/12: 1.129; 2013: 1.122.
Foursquare Deutschland, Freikirchliches Evangelisches Gemeindewerk e.V. (fegw)
1.100
2010 / REMID. Gastmitglied VEF seit 2007, seit 2014 Vollmitglied. Weitere 1.100 Zugehörige. Mitglied Arbeitsgemeinschaft Pfingstlich Charismatischer Missionen. 2018: 35 Gemeinden.
Calvary Chapel
ca. 1.000 — 2.000
2012 / REMID. 2021: 18 Gemeinden (2015: 25, 2012: 21).
Vereinigte Missionsfreunde
1.000
2005 / EG. 10 Gemeinden. Mitglied Forum Freikirchlicher Pfingstgemeinden.
Mormonen-Gemeinden außerhalb der HLT-Kirche
1.000
2005 / REMID. 13 Gemeinden
Freie Bibelgemeinde (Freie Bibelforscher Deutschland)
881
2007 / REMID.
Bund der Evangelischen Täufergemeinden
ca. 800
2014 / REMID. Insgesamt ca. 2.500 Mitglieder bei 22 Gemeinden in der Schweiz, 10 Gemeinden in Deutschland und 3 Gemeinden in Frankreich.
Gemeinschaft Christi (bis 2001: Reorganisierte Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage)
750
2004 / REMID. 11 Gemeinden, nur Getaufte
Mission Kwasizabantu Deutschland e.V / Christians for Truth (cft) / Domino-Servite-Schule
700 — 800
2003 / REMID. Andere Angabe: 1.000 (EZW 2006).
Gemeinde- und Missionswerk Arche e.V.
700
2018 / REMID. Selbstverständnis als evangelisch-reformierte Freikirche und internationales Missionswerk. Bis Ende 2008 Mitglied Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden.
Tempelgesellschaft
700
2006 / REMID. Seit 1976 dem Bund für Freies Christentum e.V. (145 eigene Mitglieder 2008, Mitglied International Association for Religious Freedom) angeschlossen. Historische Angaben: Zu Beginn der 1860er 10.000 Mitglieder.
Ernste Bibelforscher
672
2005 / REMID.
Getaufte Mitglieder.
Österreich: 132, Schweiz: 31. Die Gemeinschaft führt sich auf Charles Taze Russell zurück.
Anskar-Kirche
650
2013 / REMID. Mitglied VEF. Sechs (2021: 7) Gemeinden und 12 Gemeindegründungsprojekte. Vorige Angaben: 700 (2012), 800 (2007).
Gemeinde ohne Mauern (GoM) / International Community without walls
600
2006 / REMID.
Reformadventisten
Internationale Missionsgesellschaft der Siebenten-Tags-Adventisten Reformationsbewegung (IMG) 350
2014 / REMID.
Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten Reformationsbewegung (STAR) 200
2014 / REMID.
Vorige Angabe für Reformadventisten insgesamt: 800 (REMID 2005).
Local Churches (neo-darbystisch)
500
2010 / EZW. Vorige Angabe: 1.000 (REMID 2005).
Christian City Church (C3; nach Phil and Chris Pringle, Australien)
ca. 400 — 1.000
2015 / REMID. 4 Gemeinden.
Gemeinschaft in Christo Jesu (Lorenzianer)
400
2016 / religion-vor-ort.de. Seit 1999 Distanzierung von EKD. Historische Angaben: 1923: ca. 5.000 Anhänger (Schubert: Lorenzianer, 2010); 1984: 4.500 (Zeitschrift Wissenschaftlicher Atheismus), 2003: 3.800 (REMID).
Disciples of Christ / Christliche Gemeinde Tübingen (nach Campbell; Gründer Earl Stuckenbruck)
300
2005 / REMID.
International Churches of Christ / Boston Movement (ICC/ICOC/IGC)
300
2011 / REMID.
Emergent Deutschland (Emerging-Church-Bewegung)
270
2012 / EZW. 14 Gruppen.
Religiöse Gesellschaft der Freunde (Quäker)
250
2018 / ack-bayern.de. Ständiger Beobachter ACK. Vorige Angaben: 269 (REMID 2011), 330 (2000).
Vietnamesische Reformierte Kirche / Tin Lanh Gemeinde
250
2003 / REMID. 8 Gemeinden. Seit 2014 ist Jugendverband Mitglied im Württembergischen Ev. Jugendverband.
Apostolische Kirche — Urchristliche Mission
250
2005 / REMID. 3 Gemeinden. Mitglied Forum Freikirchler Pfingstgemeinden.
Spätregen-Mission (Latter Rain Mission International)
220
2013 / REMID. 4 Glaubenshäuser.
Neue Kirche/Union der Neuen Kirche in Deutschland (Swedenborgianer)
200
2005 / REMID. Gemeinde in Berlin.
Remonstrantse Broederschap (Remonstrantische Bruderschaft)
174
2014 / REMID. Deutsche Gemeinde in Friedrichstadt.
Weltweite Kirche Gottes (seit 3. April 2009 Grace Communion International)
ca. 130
2011 / REMID. 4 Gemeinden. Zuvor 2005: 400 in 7 Gemeinden.
Wahre Jesus Gemeinde e.V. / True Jesus Church / 真耶穌教會
100 — 400
2016 / REMID. 3 Gemeinden. Oneness Pentecostalism. In Deutschland seit 1985
MCC Basisgemeinde Hamburg — Die Kirche (nicht nur) für Lesben und Schwule
100 — 150
2009 / REMID. Mittlerweile sind weitere Gemeinden in Köln und Stuttgart entstanden (2013). Frühere Angaben: 50 (2005), 25 (1995).
1. Korinther 12:12 / “Sein wunderbares Leben heute” (Horst Schaffranek, gest. Ende 2013)
100
2012 / REMID.
Converge International Fellowship (Darmstadt)
100
2018 / REMID.
Zwölf Stämme
ehem. 100
2013 / REMID. 3 Wohngemeinschaften. Zahl vor Razzien. Vorige Angabe: 50–100 (2005). Die Zwölf Stämme haben Deutschland 2016 verlassen.
Bruderhof / Bruderhöfer / Arnoldleut
ca. 50
2018 / REMID. Selbstverständnis als “christliche Lebens- und Arbeitsgemeinschaft”. Standorte Sannerz (gegr. 2002) und Bad Klosterlausnitz (gegr. 2004).
Vereinigung Christlicher Kampfsportler
ca. 20
2015 / REMID. Zahl der Trainer_innen (bzw. Einrichtungen), welche den VCK-Richtlinien entsprechen und als solche gelistet werden. Kritik an nicht-christlichen Ideen im Kampfsport, aktive Bekehrung.