REMID
Religionswissenschaftlicher Medien- und Informationsdienst e. V.
Mitgliederzahlen: Judentum

Sie finden unsere Statistiken hilfreich? Um diese weiterhin kostenfrei und für alle zugängig anbieten zu können, sind wir für jede noch so kleine Spende dankbar. Jeder Euro zählt für uns! Ihre Unterstützung ermöglicht es uns, unser Angebot aufrechtzuerhalten und auszubauen.
Insgesamt rechnet REMID aktuell (Stand 2022) mit 90.885 Jüd*innen. Die “Jüd*innen ohne Gemeindezugehörigkeit” sind in dieser Zahl nicht enthalten. Für die sogenannten “messianischen Jüd*innen” siehe unter Sonstige.
Mitgliederzahlen als PDF
Jüdische Gemeinden
90885
2022/ ZWST. Schlüssel als KdÖR (einige Gemeinden altkorporiert): ikg, j, isnw, sg oder jgd.
Vorige Angaben: 93.695 (2020; ‑2.810), 94.771 (2019; ‑1.076), 96.325 (2018; ‑1.554), 97.791 (2017; ‑1.466). Rückgang 2017 ggb. 2016: ‑809; 2016 ggb. 2015: ‑1.101; 2015 ggb. 2014: ‑742; 2014 ggb. 2013: ‑901; 2013 ggb. 2012: ‑797; 2012 ggb. 2011: ‑662; 2011 ggb. 2010: ‑1227; 2010 ggb. 2007: ‑3306.
Mitgliedsgemeinden im Zentralrat der Juden in Deutschland. Davon Zuwanderer*innen aus Osteuropa 2007 (REMID): ca. 101.000
Juden ohne Gemeindezugehörigkeit
90.000
2007 / REMID.
Durch Zuwanderung aus Osteuropa nach Deutschland gekommen, religiöser Status im Sinne der jüdischen Religionsgesetze oft unklar.
Union progressiver Juden (UpJ)
5.200
2020 / liberale-juden.de. 2020: 25 Gemeinden (2015: 26; 2012: 24; 2007: 21; 2004: 15). Vorige Angaben: 5.000 (2012), 4.500 (2007), 3.000 (2004).
Die Gemeinden der UpJ sind zum Teil über Landesverbände Mitglied im Zentralrat der Juden in Deutschland. Sie ist seit dem 30. September 2015 eine Körperschaft des öffentlichen Rechts mit Sitz in Bielefeld.
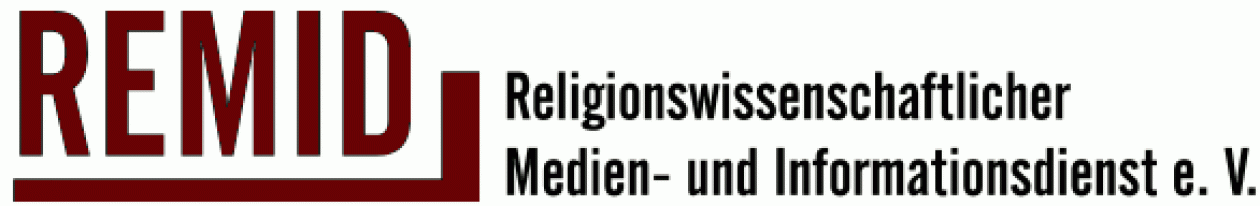
![[Antisemitische Karikatur, „Hinter der russischen/ukrainischen Maske strebt der Jude nach Konflikt“]](https://remid.de/wp-content/uploads/2023/05/Verschwoerungsmythen-e1702987919642.png)

