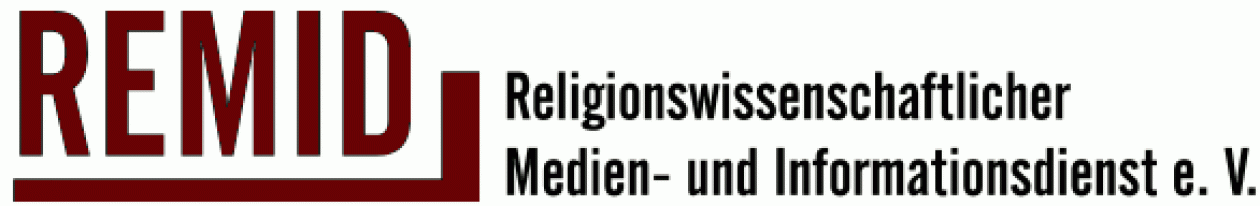REMID
Religionswissenschaftlicher Medien- und Informationsdienst e. V.
Was ist Religionswissenschaft? Was sind Theologien?
Auch wenn Religionswissenschaft als Disziplin vor ca. hundert Jahren zu guten Anteilen aus der vor allem protestantischen Theologie hervorgegangen war, unterscheidet sie sich in Zugang und Methoden von einem solchen religiösen Zugang zu Religionen als ihrem Forschungsgegenstand. Es geht gerade nicht darum, ob jemand auch Theologin oder Theologe einer Religion sein darf oder ob jemand andersherum religiöse Gefühle kennen muss, die Frage ist, ob die Forschung religionswissenschaftlichen Standards enstspricht. Während eine „Theologie“ als „Lehre von Gott“ letztlich der Verkündigung einer religiösen Wahrheit dient, „verschiebt“ sich für die Religionswissenschaft der Schwerpunkt weg von einer phänomenologischen Schau des ‚Heiligen in der Welt‘ zu einer interdisziplinären Erforschung religiöser Menschen und ihrer Vergemeinschaftungen mit Methoden der Philologien, Soziologie, Geschichtswissenschaften, Ethnologie und Psychologie.
“Theologen glauben an die Existenz Gottes, philosophische Atheisten an die Nicht-Existenz Gottes und Religionswissenschaftler an die Existenz gläubiger Menschen.”
Christoph Bochinger, Religionswissenschaftler
Im Unterschied zu einer Theologie geht es also weniger darum, z.B. selbst einer Stelle in einem sogenannten „Heiligen Text“ einen wörtlichen oder einen auf die „letzten Dinge“ bezogenen übertragenen Sinn zuzuordnen und dies mit anderen entsprechenden Stellen kanonischer Texte zu begründen, sondern eher darum, wie religiöse Menschen ihre heiligen Texte verwenden, welche Kommentare von welcher Gemeinschaft empfohlen werden usf. Ebenso geht es weniger darum, ob eine konkurrierende Textdeutung einer konfessional unterschiedenen Theologie von einer z.B. christlichen metaphysischen Wahrheit abweicht, sondern mehr darum religiöse (und weltanschauliche) Vielfalt aus einer nicht-religiösen Außenperspektive zu untersuchen, die bezüglich metaphysischer Wahrheiten einem methodischen Agnostizismus verpflichtet ist – das heißt, es wird davon ausgegangen, dass wir nicht nicht wissen können, ob es Gott gibt oder nicht.
Aufgrund ihrer besonderen Fachgeschichte, aber auch aufgrund der Besonderung des Gegenstandes beinhaltet das auch die Herausforderung, eine eigene Fachsprache zu entwickeln, denn etwa in einer naturalistischen Perspektive entzieht sich gerade die Vergleichbarkeit des Religiösen der Religionen, während die tradierten Terminologien des Christentums und der Antike entsprechend religiös gefärbt sind. Diese Herausforderung wird nicht einheitlich behandelt, in vielen Punkten haben sich unterschiedliche Umgangsweisen etabliert.
“Das Christentum” oder die christlichen Religionen
„Es liegt mir fern, eine idealtypische Religion des Christentums zu zeichnen, die sich beispielsweise am römischen Katholizismus und dem lutherischen Protestantismus orientiert. Zu leicht werden dadurch Gemeinschaften, welche die vorherrschenden Interpretationen nicht teilen, zu defizitären oder ketzerischen Gruppen herabgestuft“
Hermann Ruttmann, „2000 Jahre Christentum. Entstehung, Sozialgeschichte und Gegenwart einer Familie von Konfessionen“, Marburg 2006, S. 5.
Zwar kann religionsgeschichtlich nachvollzogen werden, wie Konzilien „Ökumene“ bzw. konfessionalen Bezug organisierten – Ephesos 431 ‚Abspaltung‘ der nestorianischen Assyrischen Kirche des Ostens, Chalcedon 451 ‚Abspaltung‘ der miaphysitischen orientalisch-orthodoxen Kirchen -, aber im Fall der isolierten Gemeinschaft steckt bereits im Wort „Sondergemeinschaft“ (oder „Sekte“) die begonnene oder vollzogene Infragestellung der jeweiligen „Christianizität“. Schließlich macht die Wertung, diese Gemeinschaft stelle ein „Sondergut“ in ihr Zentrum anstelle von einem ‚allgemeineren‘ Christlichen bereits einen Schritt in die Richtung eines Ausschlusses aus der Familie der Christentümer.
Die Hegemonie des auch die Ostkirchen einbeziehenden nicäischen Christentums (nach dem Ersten Konzil von 325; die Annahme des Nicäno-Konstantinopolitanum bzw „Großen Glaubensbekenntnisses“ ist Voraussetzung für die Aufnahme in den Ökumenischen Rat der Kirchen, World Council of Churches) darf nicht in einem dogmatischen Vorzug als „eine idealtypische Religion des Christentums“ festgeschrieben werden. Vielmehr muss klar sein, dass in vielen solchen ausschließenden Entscheidungen gerade auf beiden Seiten des dogmatischen Schismas „Christentum“ entsteht.
Text: Kris Wagenseil (2019), Aktualisierung Mona Stumpe (2023)